
Wir erheben Themen wie Wachstum, wirtschaftlichen Wohlstand oder BIP innerhalb unserer Kultur beinahe zur Religion. Politisch sind sie dies allemal. Es sind die geltenden ökonomischen Rahmenbedingungen, die einen Großteil des politischen Handlungsspektrums abstecken.
Das Wahlkampfmantra Bill Clintons aus dem Jahre 1992 brachte es auf den Punkt – It’s the economy, stupid! Mit diesem Slogan gewann er die US-Präsidentschaftswahlen.
Der Satz stammt ursprünglich von James Carville, dem Chefstrategen im Präsidentschaftswahlkampf. Carville ließ diese knappe und provozierende Phrase auf ein Schild im Hauptquartier der Kampagne in Little Rock (Arkansas) hängen. Der Slogan war ursprünglich für die internen Mitarbeiter gedacht, um sie daran zu erinnern, sich auf das wichtigste und wählerwirksamste Thema zu konzentrieren und nicht von „unwichtigeren“ Dingen ablenken zu lassen. Auf dem Schild standen drei zentrale Punkte, von denen "The economy, stupid." der zweite war:
- Change vs. more of the same (Veränderung vs. weitermachen wie bisher)
- The economy, stupid. (Die Wirtschaft, Dummkopf/Idiot.)
- Don't forget health care (Vergiss die Gesundheitsversorgung nicht)
Die Botschaft "It's the economy, stupid!" bedeutet sinngemäß:
"Egal, welche anderen Themen gerade diskutiert werden
oder wie komplex die Politik erscheint:
Am Ende ist der Zustand der Wirtschaft –
und damit die finanzielle Lage der Wähler –
das Einzige, was wirklich über den Wahlausgang entscheidet."
Zur Erinnerung:
1992 trat Bill Clinton gegen den amtierenden Präsidenten George H.W. Bush an. Bush genoss nach dem Sieg im Golfkrieg zwar hohe Zustimmungsraten in der Außenpolitik, aber die USA steckten in einer Rezession. Carvilles Strategie war es, die Wähler kontinuierlich daran zu erinnern, dass ihre persönliche wirtschaftliche Situation (Arbeitsplätze, Einkommen, Rezession) wichtiger war als die Erfolge in der Außenpolitik.
Der Satz "It's the economy, stupid!" half Clinton maßgeblich dabei die Wahl zu gewinnen, und ist einer der berühmtesten und wirkungsmächtigsten politischen Wahlslogans der modernen Geschichte. Er thematisiert erschreckend nüchtern die politische Priorisierung, bei der die kurzfristige Ökonomie – der "stupide" Zwang zum Wachstum und Profit – über langfristige existenzielle Themen wie den Erhalt der ökologischen Lebensgrundlage gestellt wird. Dies ist auch der Grund, warum keine Regierung dieser Welt jemals gegen ihre eigene Wirtschaft agieren würde. Und genau deshalb kommen wir beim Klimaschutz respektive der Emissionsminderung in wissenschaftlich geforderten Dimensionen nur so schleppend voran. Denn die notwendige Transformation unserer gesamten Gesellschaft, wie wir sie heute kennen, kostet zunächst einmal gigantische Investitionen. Selbst wenn sich diese natürlich langfristig auszahlen, erst einmal gefährden diese Ausgaben die Wettbewerbsfähigkeit, weil die Kosten auf die Endprodukte aufgeschlagen werden und diese teurer machen - zumindest ggü. den Produkten der Länder, die dies noch nicht oder nicht (mehr) tun, wie beispielsweise die USA.
Es ist eine uralte Weisheit:
„Sobald Nachhaltigkeit mit kurzfristigen
Wirtschafts- und Profitinteressen konkurrieren muss,
gewinnt IMMER das Geld.“
Unser Wirtschaftssystem stellt Geld und Profit über alles andere - auch über den Erhalt unserer ökologischen Lebensgrundlage. Die Ökonomie scheint der ausgemachte Gegner der Nachhaltigkeit zu sein. Ein weiteres ungelöstes Problem ist der fortwährende Zwang zum immer weiteren Wachstum. Unsere Welt scheint einem ständigen Beschleunigungszwang unterworfen – eine Dynamik, die sich so nicht mehr lange aufrechterhalten lässt.
Kapitalismus und die ökologischen Grenzen des Wachstums
Woraus resultiert eigentlich der systemimmanente Zwang zum Wachstum innerhalb unseres kapitalistischen Wirtschaftssystems? Der Zwang zur Prosperität resultiert u.a. aus dem Zinseffekt und dem Bestreben aus Kapitalanlagen einen Gewinn zu erzielen. Denn neben den Betriebskosten eines wertschöpfenden Unternehmens muss darüber hinaus immer auch der erwartete Zins des Kapitalgebers erwirtschaftet werden. Dies verlangt zwingend, neben dem Amortisieren der eigenen Betriebsausgaben, einen weiteren Posten zu erwirtschaften, nämlich den Kapitalgewinn. Dies verteuert die hergestellten Produkte bzw. Dienstleistungen und führt zu einer stetigen, sich selbst beschleunigenden immanenten Aufwärtsspirale der Preise. Wachstum ist innerhalb dieses Systems unumgänglich, damit es weiter bestehen kann. Unreguliert beschleunigt dieser Effekt überdies die zunehmende wirtschaftliche Ungleichheit, da Vermögen durch Kapitalanlagen (leistungslos!) immer weiter anwachsen. Darüber hinaus ist dieses Wirtschaftssystem toxisch für die Ökosysteme, denn fortwährendes Wachstum auf einem Planeten mit endlichen Ressourcen ist unmöglich, und muss zwingend an seine Grenzen stoßen - was gerade tatsächlich passiert.
Dennoch werden mittlerweile die Ziele des Klimaschutzes (und andere Zukunftsthemen) von vielen Parteien ganz unverhohlen relativiert bzw. ganz infrage gestellt. Mehr noch: die größte Volkswirtschaft der Erde ist jüngst ungeniert aus dem Pariser Klimaschutzabkommen ausgestiegen. Und dies nicht etwa nach der Machtübernahme, überraschend und unerwartet, sondern ganz offenkundig und mit Ansage - mandatiert von deutlich mehr als 50 % der amerikanischen Bürger! Niemand kann also heute behaupten man hätte nicht gewusst was da kommt.
Aber warum ist das so?
Viele Menschen (auch jenseits des großen Teiches) haben verstanden, dass wir auf eine Klimakatastrophe zusteuern. Aber fast genauso viele fühlen sich, nachvollziehbarerweise, ohnmächtig aufgrund der Größe des Problems – auch mangels ungenügender klimafreundlicher Konsum- und Mobilitätsalternativen. Auch wollen die Meisten keine Verteuerungen oder persönliche Einschränkungen akzeptieren. Klimapolitische Instrumente funktionieren aber maßgeblich über Verteuerungen. Diese haben daher ein massives Akzeptanzproblem, da sie nicht nur die Wettbewerbsfähigkeit der heimischen Industrie gefährden, sondern darüber hinaus auch einkommensschwächere Haushalte überproportional belasten. Das Dilemma, in dem die Politik steckt könnte man so beschreiben:
„Klimaschutz ja,
aber nur so lange dadurch nicht meine persönliche Komfortzone
oder das eigene Portemonnaie betroffen sind.“
In den USA wurde ein notorischer Klimaleugner Präsident. Stellt sich die Frage nach dem Warum. Schließlich hatte er offen angekündigt was er vorhat: Aus dem Pariser Klimaabkommen aussteigen, keine Windkraftanlagen mehr zu genehmigen und auf Teufel komm raus nach Erdöl zu bohren „drill baby drill!“. Trotzdem haben sie ihn überraschenderweise gewählt. Und weswegen? Ganz einfach. Weil er versprochen hat, dass es allen wirtschaftlich besser gehen wird. Die Menschen denken in erster Linie an ihr eigenes, kurzfristiges Wohlergehen - it's the economy stupid.
Warum wir Klimafolgekosten nicht länger sozialisieren dürfen
Unser Wirtschaftssystem hat einen beachtlichen Wohlstandsgewinn in vielen Volkswirtschaften ermöglicht. Doch dieselbe Logik, die Wertschöpfung perfektioniert hat, perfektioniert auch das Wegsehen: Klimafolgen, Biodiversitätsverluste und langfristige Schäden an Infrastruktur und Gesundheit tauchen eher am Rande auf – in Mahnungen seitens der Wissenschaft, Risiko- und Nachhaltigkeitsberichten oder unter „nicht-finanzielle KPIs“. Ökonomisch gesprochen: Diese negativen Effekte bleiben externalisiert. Gewinne werden privatisiert, die Folgekosten unseres Wirtschaftens jedoch sozialisiert – über Steuern, höhere Versicherungsprämien, Abgaben, öffentliche Haushalte. Die unbeabsichtigte Ironie: Unser marktwirtschaftliches System ist überaus effizient – in dem Zielsystem, das wir ihm vorgeben. Wenn CO2-Emissionen jedoch (noch) kein harter, universeller Produktionsfaktor sind, optimieren Märkte berechtigterweise an ihnen vorbei.
Externalitäten sind kein Betriebsunfall – sie sind Systemlogik
Unternehmen minimieren wie selbstverständlich Gesamtkosten entlang ihrer Wertschöpfungskette: Rohstoffe, Verarbeitung, Transport, Vertrieb, etc. Was nicht mit einem Preis belegt ist – wie etwa Emissionen, die in der Raffinerie, im Stahlwerk oder in der Logistik anfallen – erscheint als „kostenfrei“. In Wahrheit handelt es sich um verlagerte Kosten: Folgekosten aus Extremwetterereignissen, Massenmigration, Gesundheitslasten, etc. – und dies über Jahrzehnte, wenn nicht Jahrhunderte.
Warum Preissignale allein nicht reichen
Kohlenstoffsteuern und Emissionshandel sind ökologisch sauber begründet. In der Praxis kämpfen sie jedoch mit harten Problemen – u.a. den politischen und gesellschaftlichen Durchsetzungsgrenzen: Steuern auf Energie sind regressiv spürbar. Hohe Preisniveaus stoßen an gesellschaftliche Akzeptanzgrenzen; Ausnahmen und Kompensationen höhlen deren Wirkung aus. Das Ergebnis ist häufig ein bis zur Bedeutungslosigkeit verwässerter Kompromiss, der zugleich zu viel Politik und zu wenig Lenkungswirkung enthält.
Der blinde Fleck der Geldmonokultur
Solange nur eine Recheneinheit - nämlich Geld – die Ressourcenknappheit von THG-Emissionen aus fossilen Brennstoffen abbilden soll, überlasten wir sie: BIP, wirtschaftlicher Wohlstand, Profit, Wettbewerbsfähigkeit und Klimaziele in einem Kanal zu regulieren, führt absehbar zu Zielkonflikten. Wer CO₂ in Dollar, Yen und Euro presst, macht Klimapolitik abhängig von Geldpolitik, Konjunktur und Wahlzyklen. Ein fragiles Design.
Das Trilemma der Klimapolitik zwischen Regierung, Industrie und uns Bürgern:
- Regierungen: Für Staaten ist es, in Legislaturperioden gedacht, ökonomisch sinnvoller nicht oder nur zögerlich in Klimaschutz zu investieren, denn dies bedeutet, zumindest kurzfristig, einen Kosten- bzw. Standortvorteil gegenüber anderen Ländern, und somit einen Vorsprung für die eigene Wirtschaft. Für Regierungen ist es daher innenpolitisch zweckmäßig, Klimaschutzmaßnahmen nicht zu stark zu forcieren. Zum einen, um die Konkurrenzfähigkeit der eigenen Wirtschaft nicht zu gefährden – vor allem im internationalen Kontext. Zum anderen, um die Bürger, respektive die Wähler, nicht zu überfordern bzw. zu verlieren. Denn jede Regierung ist auch an Machterhalt und Wiederwahl interessiert, und Klimaschutz ist nur so lange mehrheitsfähig, solange er nicht zu sehr die persönliche Komfortzone der Menschen bzw. deren Portemonnaies betrifft.
- Die Industrie hingegen will keine zusätzlichen Regularien bzw. finanzielle Aufwände für die Defossilisierung ihrer Herstellungsprozesse. Einerseits aus Sorge vor dem Verlust der Wettbewerbsfähigkeit und andererseits, weil deren primäres Interesse Wachstum und Profit ist – nicht Klimaschutz.
- Bürger: Weiterhin können wir das Klimaziel nur erreichen, wenn unser Konsum weitestgehend klimaneutral produziert wird. Denn Appelle an Einschränkung und Verzicht sind unpopulär. Eine Reduzierung unseres derzeitigen, weitestgehend noch fossil basierten Konsumvolumens auf ein Maß, das dem völkerrechtlich abgestimmten Emissionsminderungspfad entspräche, ist unrealistisch.
Diesen Teufelskreis aus der Diffusion von Verantwortung, nationalen Interessen und globalen Notwendigkeiten können wir nur durch einen mehrheitsfähigen Paradigmenwechsel durchbrechen, um so endlich der Krise entsprechend handeln zu können. Denn dies ist aus o.g. Gründen im gegenwärtigen, im Wesentlichen auf egoistischem Profitstreben ausgerichteten kapitalistischen System nicht möglich. Die Realität zeigt, die zu verzeichnenden Fortschritte finden viel zu langsam statt. Es steht jedoch alles auf dem Spiel.
Der monetäre Ansatz und seine Grenzen
Es gibt einfach keinen Platz mehr für Illusionen - wir sind beim Klimaschutz nicht auf Kurs. Überall auf der Welt ist dieses Thema auf dem Rückzug. Klimaschutz hat ein massives Akzeptanzproblem. Dies liegt im Wesentlichen daran, dass Nachhaltigkeit gegen Wirtschaftsinteressen ausgespielt wird. Erschwert wird das Ganze dadurch, indem beharrlich versucht wird, Klimaschutz maßgeblich über Verteuerungen und innerhalb des monetären Geldsystems abzubilden, was zunehmend an seine Grenzen stößt. Denn dies ist mit eklatanten Nachteilen verbunden. Zum Beispiel im Bereich der Wirtschaft und deren Wettbewerbsfähigkeit und nicht zuletzt auch für Privathaushalte. Vor allem für einkommensschwächere Menschen bedeuten Verteuerungen schlussendlich Einschränkung und Verzicht, während Wohlhabenden kaum Nachteile entstehen.
Ein weiteres ungelöstes Problem, weswegen Klimaschutz zunehmend unsexy geworden ist: Den Bürgern fehlt es an niedrigschwelligen klimafreundlichen Alternativen in ausreichendem Maße. Denn die Aufgabe der Konsumenten, die Wahl zu treffen, was sie kaufen, bedingt zwingend eine ausreichende klimafreundliche Wahlmöglichkeit. Und gerade dies ist im gegenwärtigen System nicht hinreichend gegeben.
Da Konsumeinschränkung und Verzicht den Grundregeln unseres kapitalistischen Wirtschaftssystems, das zwingend auf Wachstum angewiesen ist, massiv entgegenwirken, wird auch aus diesem Grund eine ausreichend wirksame Verschärfung des Systems immer wieder verschoben bzw. durch Gegenkompensationsmaßnahmen konterkariert.
Aus all diesen Gründen finden klimapolitische Maßnahmen kaum noch Zustimmung – weder innerhalb der Wirtschaft noch aus der Bevölkerung – selbst bei denen, die die Ernsthaftigkeit des Problems erkannt haben und deshalb grundsätzlich für mehr Klimaschutz sind.
Und notwendige Gesetzesvorlagen erzielen zunehmend keine politischen Mehrheiten mehr - ganz im Gegenteil. Bereits beschlossene Maßnahmen werden oft hinausgezögert, deutlich entschärft bzw. komplett zurückgenommen. Dies belegen eindrücklich die Ereignisse, die wir bereits in einem früheren Blog aufgegriffen hatten: Wir sollten mehr Demokratie wagen
Die Marktmacht der Konsumenten vs. the economy stupid - wie eine komplementäre Klimawährung ECO Märkte endlich in die richtige Richtung lenkt
Wie bringen wir die naturwissenschaftlich geforderte Emissionsbilanz in dieselbe Prioritätsebene wie die Profitbilanz – ohne Wohlstand fahrlässig zu verspielen? Die Non-Profit-Organisation für nachhaltige Ökonomie, SaveClimate.Earth, schlägt an dieser Stelle die Entkopplung klimapolitischer Steuerung vom Geldsystem vor - über die Einführung handelbarer persönlicher Emissionsbudgets, mittels einer komplementären Klimawährung namens ECO (Earth Carbon Obligation). Nicht als Ersatz für Landeswährungen, wie den Euro, sondern als zweite, gleichrangige Buchführung: Geld für wirtschaftlichen Wert - ECO für Emissionen.
Eine neue Lösung: Emissionsbudgets für alle - Emissionsvolumen wird eigene Währung
Wie könnte das funktionieren? Das monetäre Geldsystem macht - ganz automatisch - alle Systeme im wirtschaftlichen Sinne effizient. Weil nach marktwirtschaftlichen Mechanismen - intrinsisch motiviert - ganz selbstverständlich solche Technologien eingesetzt werden, mit denen am kostengünstigsten und mit dem geringsten Aufwand produziert werden kann. Dies geschieht jedoch im jetzigen System leider nicht auch gleichzeitig im Sinne der Nachhaltigkeit.
Aufgrund dieser Erkenntnisse sollten wir auch hierfür ein autonom wirkendes, komplementäres System etablieren, welches die Dinge ebenso im ökologischen Sinne durchgreifend effektiv gestaltet, indem es auf das gleiche bewährte Prinzip zurückgreift – den Markt.
Die erforderlichen Rahmenbedingungen schafft dabei - initial innerhalb der EU eingeführt - eine komplementäre Kohlenstoff-Ressourcenwährung, die auf Basis der gleichen marktwirtschaftlichen Mechanismen grüne Innovationen fördert und so auch Nachhaltigkeit effizient macht. Personal Carbon Trading bzw. begrenzte persönliche Emissionsbudgets bewirken, dass wir Verbraucher Dinge mit einem kleineren CO2-Fußabdruck favorisieren. Der Effekt dabei: Die Industrie produziert letztlich das, was wir Bürger kaufen, bzw. mit unseren persönlichen Emissionskontingenten kaufen können. So findet eine intrinsisch motivierte Defossilisierung unserer Wirtschaft statt. Denn:
„Das sich verändernde Nachfrageverhalten
und die Marktmacht von nahezu 500 Millionen Konsumenten
bewirkt eine deutlich schnellere Transformation der Industrie
und deren Herstellungsprozesse als alle derzeitigen
klimapolitischen Weichenstellungen."
So kommen auch im nachhaltigen Sinne automatisch die Technologien zum Einsatz, die mit dem geringsten Aufwand und den niedrigsten Kosten die meiste Emissionsreduktion bewirken. Wirtschaftliche Interessen sind so im Einklang mit ökologischen Notwendigkeiten – ganz ohne der Erfordernis stattlicher Interventionen. Klimaschutz und soziale Gerechtigkeit können Hand in Hand gehen, da dieses Instrument ordnungsrechtliche Verteuerungen obsolet macht.
- Marktwirtschaftliche Gesetzmäßigkeiten bewirken, dass unsere Industrie und Gesellschaft so agieren, dass es im monetären Sinn wirtschaftlich ist. Umweltschutz spielt innerhalb unseres gegenwärtigen Systems eine stark untergeordnete Rolle.
- Da unser Konsumverhalten jedoch zunehmend an planetare Grenzen stößt, sollten wir einen zweiten marktwirtschaftlichen Mechanismus ergänzen, um ökologische Ressourcen ebenfalls effektiv zu managen.
- Mit Hilfe einer komplementären Ressourcenwährung können Geldströme gezielt gelenkt werden, um sie an die Orte fließen zu lassen, die auch Nachhaltigkeits- oder Umweltaspekte berücksichtigen.
Die Grundidee: Der ECO als zweites Budget
ECO steht für Earth Carbon Obligation. Es ist eine komplementäre Währungseinheit, die ausschließlich das Recht abbildet, eine bestimmte Menge Treibhausgasemissionen zu verbrauchen. Sie ist knapp (Budget orientiert sich an wissenschaftlichen Reduktionspfaden), handelbar (Marktpreis bildet Knappheit ab) und persönlich zugeteilt (pro Kopf). Geld (€) bleibt Zahlungsmittel für Wertschöpfung; ECO bildet den ökologischen Preis einer jeden Sache ab – beides ist beim Konsumieren fällig.
Wie das praktisch funktioniert
- Zuteilung: Alle Bürger erhalten ein monatliches ECO-Budget (digitales Konto/Wallet). Die Summe aller Budgets bildet den zulässigen Emissionsdeckel einer Volkswirtschaft.
- Verwendung: Beim Kauf emissionsbehafteter Güter/Dienstleistungen wird neben Landeswährung auch ein ECO-Betrag vom persönlichen Klimakonto abgebucht, der dem CO2-Fußabdruck entspricht, der entlang der gesamten Wertschöpfungskette entstanden ist.
- Handel: Wer sparsamer konsumiert, kann ECO verkaufen; wer mehr Emissionen verursacht, kauft die zusätzlich benötigten ECO direkt von Niedrigemittenten an der Klimabörse (Handelsplatz für ECO).
- Preisbildung: Der ECO-Preis entsteht autonom, interpretationsfrei und manipulationssicher entlang der gesamten Wertschöpfungskette.
- Pfad: Der Gesamtdeckel sinkt planbar (z. B. jährlich), sodass der Markt frühzeitig Investitionssignale in Richtung Defossilisierung sendet.
Wichtig: ECO ist kein „grüner Euro“, sondern eine zusätzliche Restriktion. Ein Produkt ist nur dann käuflich, wenn man beide Bedingungen erfüllt: genügend Geld und genügend ECO besitzt.
Warum das wirksamer ist
- Zielklarheit: Der Deckel garantiert die Einhaltung des Emissionspfads – unabhängig von Konjunktur, Zinsniveau oder Rebound-Effekt.
- Fairness: Pro-Kopf-Zuteilung schafft eine für alle gleiche Grunddividende in ECO - als monatliches ökologisches Grundeinkommen für alle. Der damit verbundene Gerechtigkeitsaspekt schafft eine breite Akzeptanz. Haushalte mit kleinem Fußabdruck profitieren durch ECO-Verkäufe; Vielverbraucher zahlen drauf, nicht abstrakt über Steuerumlagen, sondern direkt über den ECO-Markt an Niedrigemittenten.
- Technologieneutralität: Es gewinnt die Technologie, welche Emissionen je Nutzen am stärksten drücken kann – egal durch welche Prozessinnovation.
- Inflationsrobustheit: Lenkung erfolgt von der Geldpolitik entkoppelt - durch die Steuerung des Gesamtausgabevolumen des ECO.
Vom Prinzip zur Praxis: Was sich konkret ändern würde
Für Verbraucher: Beim Wocheneinkauf, bei der Flugbuchung, beim Gerätekauf: Der Kassenzettel zeigt zwei Summen – in Euro und ECO. Ein regional und klimafreundlich produziertes Produkt hat niedrigere ECO-Kosten, importierte, (fossil)energieintensive Ware höhere. Wer radelt, Wärmepumpe nutzt oder seltener fliegt, spart ECO und kann Überschüsse verkaufen. Die Wahlfreiheit bleibt – aber mit echter Knappheit als Lenkungswirkung.
Für Unternehmen:
- Kalkulation: ECO wird zur Produktionsrestriktion, genau wie Energie oder Zeit. Wer Prozesse defossilisiert, senkt den ECO-Input je Einheit – und gewinnt Kostenvorteile in beiden Dimensionen.
- Beschaffung: Einkaufsteams fordern ECO-Kostenvoranschläge von Zulieferern. Lieferanten mit geringerem Emissions-Footprint werden bevorzugt – nicht aus PR-Gründen, sondern aus Kostengründen.
- Für die Wettbewerbsfähigkeit: An der Grenze wird die ECO-Last importierter Güter erfasst (analoger Mechanismus zum CBAM). Importeur oder Endkunde müssen entsprechende ECO abführen. Carbon Leakage verliert komplett seinen Anreiz.
Beispielhafte Wirkungsketten
- Zement/Stahl: Ein Bauprojekt kalkuliert Euro und ECO. Zement mit CCS, grüner Stahl, modulare Holz-Hybridlösungen werden unmittelbar ECO-attraktiv. Architekten planen materialeffizienter - nicht aus moralischem Impuls, sondern aus Budgetlogik.
- Mobilität: Kurzstreckenflüge kosten verhältnismäßig viele ECO; Bahnreisen, E-Busse und Carsharing deutlich weniger. Geschäftsreisen werden selektiver.
- Konsumgüter/Mode: Fast-Fashion mit hoher Emissionslast verliert Preiskampf in ECO; langlebige, zirkuläre Produkte gewinnen – auch wenn sie in Euro teurer sind. Gesamtkaufpreis = € + ECO verändert Präferenzen.
Der ECO ist mengenbasiert. Es limitiert nicht Wertschöpfung per se, sondern Emissionsintensität. Wachstum kann dennoch stattfinden, wenn Emissionen je Einheit stark sinken. Das System setzt Wachstum unter Innovationsdruck, nicht unter pauschales Verbot.
Was sich gesamtgesellschaftlich ändert: Von der Bitte zur Bilanz
Klimapolitik war zu oft Erziehungsprojekt, zu selten Strukturprojekt. Mit dem ECO wird aus moralischer Aufforderung und Verbotspolitik eine harte Budgetlogik. Für alle - fair verteilt. Buchhalter buchen zwei Posten – einen für den wirtschaftlichen Preis und einen für den ökologischen Preis, Konsumenten entdecken den Wert von Langlebigkeit – nicht aus Idealismus oder Askese, sondern aus Rationalität.
Fazit: Kapitalismus neu kalibriert
Der Kapitalismus muss nicht „überwunden“, sondern umgestellt werden – von einer Geldmonokultur auf ein Dualsystem. Geld bleibt das Maß für Wert und Zeit. ECO wird das Maß für Emissionen und damit für die ökologische Tragfähigkeit unseres Handelns. Nur so hört das Sozialisieren von Klimafolgekosten auf, und Investitionen fließen dorthin, wo sie sowohl in Euro als auch in ECO am meisten Nutzen pro Einheit stiften.
Die Logik ist schlicht: Unsere wirtschaftliche Kaufkraft unterliegt einem Budget. Für Emissionen fehlt es bisher noch. Die Einführung einer komplementären Klimawährung ist kein exotischer Umsturzversuch, sondern überfällige Erweiterung der Buchhaltung – die „zweite Zeile“ in der Gewinn- und Verlustrechnung des 21. Jahrhunderts.
Die entscheidende Stärke des Marktes ist nicht Moral, sondern Koordination. Mit dem ECO geben wir ihm das richtige Koordinatensystem. Dann wird aus einem System, das Klimakosten externalisiert, eines, das Klimanutzen internalisiert – effizient, fair und planbar. Genau das erwarten wir von einer Wirtschaftspolitik, die ihren Namen verdient.
Weitere Informationen zur Klimawährung ECO: www.saveclimate.earth
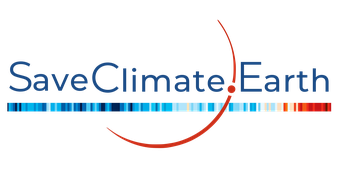
Dies ist ein Beitrag des Blogs ECOlogisch der Klimaschutz NPO Saveclimate.Earth - Organisation für nachhaltige Ökonomie.
Text: Jens Hanson, Angela Hanson
